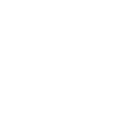Als ich im Herbst 2015 am Epstein Barr Virus erkrankte, ahnte ich nicht im Geringsten, welche Reise mir bevorstehen sollte. Ich war 23 Jahre alt, war in den Endzügen meiner Bachelorarbeit, während ich bereits den ein oder anderen Unikurs für mein anschließendes Masterstudium besuchte. Ich arbeitete zu dieser Zeit viel in dem italienischen Restaurant, in dem ich schon zu Abiturszeiten jobte. Ich kellnerte eigentlich gerne, nur waren die Arbeitszeiten solala cool, denn ich arbeitete immer dann, wenn andere frei hatten - nämlich an den Abenden des Wochenendes. Auch kam hinzu, dass das Restaurant in meiner Heimatsstadt war und ich zum Ausüben meines Nebenjobs gezwungen war, das Wochenende bei meinen Eltern zu verbringen. Nicht, dass die Zeit zu Hause so schlimm war, aber ich war eben nicht bei meinen Freunden des Studiums, hatte an den Wochenenden erst nach Feierabend gegen 23 Uhr Zeit weg zu gehen, Freunde zu treffen und ich war es irgendwann einfach leid, ständig von A nach B zu fahren, aus meiner Reisetasche zu leben und fühlte mich gehetzt.
Meine Abinoten waren leider nicht gut genug für das Studium, dass ich mir eigentlich kurz vor Studiumsbeginn rausgesucht hatte, also suchte ich etwas ähnliches. Etwas, dass mit meinen unterdurchschnittlichen Abinoten möglich war. Es wurde dann ein Studium der Medieninformatik. Das Studium war ganz okay, hauptsächlich aber wegen der tollen Freunde, die ich dort fand. Und verblüffenderweise waren meine Noten im Vergleich zur Schule wirklich gut. Also blieb dabei. Und dann, im November 2015 hatte ich, wie irgendwie jeden Winter, eine Erkältung oder sowas. Erst mal war es nichts Schlimmeres, als ich es schon kannte. Mir fehlte etwas mehr die Stimme als sonst und vielleicht brauchte ich zwei, drei Tage länger zum Auskurieren. Dann aber war ich erst mal wieder soweit fit. Die nächsten Wochen darauf aber, machte sich eine sehr bemerkenswerte Erschöpfung breit. Ich fühlte mich plötzlich anders, schleppte mich ber durch mein en Alltag, bis ich Mitte Dezember beim Autofahren auf der Autobahn für eine Millisekunde ohnmächtig wurde und ich mich plötzlich ziemlich nah an den Leitplanken wiederfand. Ich riss das Lenkrand wieder an mich, machte die Fenster auf und ließ die kalte Winterluft hinein und hielt wenige Meter weiter am Seitenstreifen an. Ich zitterte am ganzen Körper, weinte und rief meinen Papa an. Das war der Moment, als mir bewusst wurde, dass irgendetwas gar nicht mehr stimmte.
Gleich in der darauffolgenden Woche schlug ich beim Hausarzt auf und erklärte meine Situation. Ich wurde jedoch mit einer mangelnden Erklärung abgewiesen und nach Hause geschickt. Eine ganze Ladung an Symptomen machten sich mittlerweile breit und ich fühlte mich alles andere als gut. Ich ging also erneut zum Arzt und weil es mir meine Symptome mittlerweile fast unmöglich machten, Auto zu fahren, begleitete mich mein Papa zum Arzt. Im Behandlungszimmer angekommen, wurde ich erneut vertröstet und mir wurde versichert, dass alles ganz normal mit mir sei. Als meine Augen schon mit Tränen gefüllt waren und mein Kopf nicht tiefer hätte hängen können, griff mein Papa mit ein und machte deutlich, dass irgendetwas plötzlich nicht mehr stimmte und so bekam ich neben einem Blutbild, eine Überweisung zum Internisten. Wenige Wochen später stellte dieser dann fest, dass ich einen schweren Verlauf einer Epstein Barr Infektion hatte. Die aktue Infektion sei längst vorbei, meine Milz und Leber hingegeben waren geschwollen und kämpften wohl noch ordentlich mit den Folgen des Virus. Ich bekam eine sechswöchtige Bettruhe verordnet. Endlich aber hatte ich eine Diagnose.
Ich erinnere mich daran, wie ich unter Tränen sämtliche Treffen der kommenden sechs Wochen absagte, wie ich meinem Chef erkärte, dass ich jetzt erst mal nicht kellern kann, solange ich das Bett hüten muss und meinen Mitbewohnern, dass ich jetzt erst mal für die kommende Zeit wieder ins Kinderzimmer bei meinen Eltern einziehen würde. Und mit jedem Tag der verging, wurde meine Langeweile immer größer und die Erkenntnis, dass sich meine Symptome nicht zum besseren verändern, immer frustierender. Nach sechs Wochen nahm ich, soweit möglich, mein normales Leben wieder auf. Leider musste ich mehr als einmal feststellen, dass ich mit diesem Tempo nicht mehr mithalten konnte. Ich war erschöpft, konnte mich nicht konzentrieren. Die Heizungsluft in Räumen waren eine Qual für mich. Ich fühlte mich, als würde ich vor fehlendem Sauerstoff ersticken. Ich fühlte mich fiebrig und schlapp. Herzrasen, Schwindel und Kreislaufprobleme wurden immer stärker. Mein Arzt war recht unbeeindruckt, denn postvirale Erschöpfung kann für Wochen bis mehrere Monate nach einer Infektion schon mal vorkommen. Etwas Mitgefühl dafür, wie blöd das natürlich für mich sein mag, mich noch einige Wochen bis Monate zu gedulden und mich in der Zeit viel auszuruhen und gezielt auf die Grenzen meines Körpers zu achten, bekam ich schon, doch dann war meiner Behandlungszeit auch schon vorbei und ich wieder auf dem Nachhauseweg.
Es vergingen Wochen und nichts veränderte sich. Drei Monate nach der Infektion ging es mir eher schlechter als besser und je näher die Sechsmonatsgrenze rückte, die mir mein Arzt nannte, desto nervöser wurde ich. Mein Zustand verbesserte sich nicht. Ich hatte Angst, denn irgendwas stimmte ja offensichtlich überhaupt nicht.
Es war irgendwann im Sommer 2016 und der Ärztemarathon begann. Ich hatte irgendwann aufgehört, zu zählen, wie oft ich beim Hausarzt vorsässig war. Ich bekam ein Blutbild nach dem anderen. Keines davon war auffällig und erklären konnte mir der Arzt ja sowieso nicht, was mit mir nicht stimmte. Seiner Erfahrung und Meinung nach, hätte ich ja spätestens sechs Monate nach Infektion wieder topfit sein müssen. Warum das nun nicht so sei und was ich denn jetzt tun kann, wusste er auch nicht. Ich drängte also darauf, zu Fachärzten gehen zu dürfen, holte mir eine Überweisung nach der anderen. Wartete Wochen zwischen den Terminen und zwischen neuen Überweisungen, nur damit festgestellt werden konnte, dass nichts festgestellt werden kann. Diese Odysee ging monatelang. Dann fasste ich an einem Morgen, an dem mir meine Symptome Todesangst machten und ich mich kaum auf den Beinen halten konnte, den Entschluss, mich in die Notaufnahme fahren und mich stationär einweisen zu lassen. Es war mein Geburtstag und den verbrachte ich damit, stundenlang auf die Entscheidung des diensthabenden Arztes zu warten, ob ich bleiben darf oder gehen muss. Am Nachmittag bekam ich ein Zimmer, mein Papa kaufte Himbeerkuchen beim Bäcker des Krankenhauses und wir aßen meinen Geburtstagskuchen in voller Hoffnung, dass die kommenden Tage auf der internistischen Station Klarheit bringen würden.
Spoiler: Das taten sie nicht. Ich wurde vier Tage später entlassen und die Suche nach der Ursache meiner Symptome setzte sich fort. Ich traf den Entschluss, selbst in die Recherche einzusteigen, ging den Spuren nach, die mein Körper mir zeigte. Ich recherchierte den EBV-Virus, Spätfolgen, meine Symptome und die Zusammenhänge von verschiedenen Krankheitsbildern, fand diagnostische Möglichkeiten verschiedener Symptombilder heraus und legte meine Ideen stets meinem Hausarzt für weitere Schritte vor. Mein Hausarzt war überfordert und nachdem ich bei Fachärzten aller denkbaren Bereiche ohne Befund vorsässig war, schickte mich mein Hausarzt mit den Worten "es gibt nichts, dass es nicht gibt und ich bin hier am Ende meiner Weisheit" zu einer Heilpraktikerin, dessen Namen er mal irgendwo zufälligerweise hörte. Dort war ich irgendwann wöchentlich in Behandlung, trank eklig schmeckende Kräutertees, ließ mir Akkupunkturnadeln in jede denkbare Stelle meines Körpers pieksen, bis ich auch hier nach über einem Jahr, ebenfalls mit der Aussage, dass nichts weiter für mich getan werden kann, eine Empfehlung für einen weiteren Arzt erhielt. Zeitlich überschneidend hierzu untersuchte eine Mikrobiologin mein Blut auf genauste Weise. Sie verordnete mir Nahrungsergänzungsmittel für hunderte von Euros, schrieb mir eine strenge zuckerfreie, hochwertige Ernährung vor und ordnete mir einen neuen Lebensstil an. Hoffnungslos suchte ich nebenher weiter nach Ursachen und Lösungen, ging von Arzt zu Arzt, hielt mich an jedem Strohhalm fest, bezahlte teure Heilpraktiker und Privatärzte, forderte neue Überweisungen und Tests an, ließ mich von einer Schamanin umtanzen, von Psychotherapeuten schikanieren und von Ärzten abwimmeln. Und irgendwann stieß ich bei meinen vielen Recherchen auf das chronische Erschöpfungssyndrom, kurz CFS. Ich bin schon mehrfach über diese Bezeichnung gestoßen, allerdings habe ich das nicht für mich angenommen, oder viel eher auch nicht annehmen wollen. Und dann saß ich an diesem einen Tag im Bus von der Uni nach Hause. Ich musste den Tag mal wieder aufgrund von überkommenden und einnehmenden Symptomen abbrechen. Also nahm ich mein Handy in die Hand und laß endlich mehr zu dem Symptombild, dass ich bislang nicht wahrhaben wollte. Ich erinnere mich an das Gefühl, dass ich bei dieser Busfahrt hatte, als wäre es gestern gewesen. Ich weinte stark, musste mir ständig die Tränen wegwischen, um überhaupt weiterlesen zu können. Ich fühlte mich endlich verstanden. Noch nie war ich mir bei irgendetwas so sicher. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass ich mich irren könnte und ich fühlte mich endlich verstanden. Endlich hat all das einen Namen und ich fühlte mich angekommen, erleichtert. Die Suche hatte ein Ende - so dachte ich zu diesem Zeitpunkt jedenfalls. Und gleichzeitig riss es mir den Boden unter den Füßen weg. Ich litt unter einer, wie es dort stand, unheilbaren Krankheit, deren Verlauf keine Hoffnung auf Besserung erlaubte. Ich war doch erst 25 Jahre alt und mein ganzes Leben steht mir noch bevor.
Die nächsten Wochen waren hart. Ich versuchte mir der Diagnose klarzukommen. Meine Eltern vermittelten mir, dass sie an all dem zweifeln würden. Ich merkte aber, dass sie es nicht taten. Sie waren einfach überfordert damit, dass ihre Tochter ein so schlimmes, hoffungsloses Krankheitsbild diagnostiziert bekam. Ich erzählte meinen engsten Freunden von meiner Krankheit und meine Zukunftsaussichten. Ihre Reaktionen versuchten Mitgefühl zu vermitteln, das meiste das jedoch bei mir ankam, war ebenfalls Überforderung. Übel nehmen kann ich ihnen das nicht, geholfen hat es mir aber auch nicht.
Es war Herbst und meine EBV-Infektion jährte sich nun zum zweiten Mal. Es vergingen bereits 730 Tage, an denen ich mich elend fühlte und meinem alten Leben nachtrauerte. Mir ging es von Woche zu Woche schlechter. Ich überlegte, wie mein Leben weitergehen sollte, so hoffungslos meine Aussichten. Ich war besessen davon, mich weiter in das Krankheitsbild einzulesen, schaute mir jeden Film zum Chronischen Erschöpfungssyndrom an, laß jeden Artikel dazu. Ich war Mitglied in Foren und Facebookgruppen, in welchen sich Betroffene und Angehörige austauschten. Ich saugte wirklich alles hierzu auf. Innerhalb weniger Wochen verschlechterte sich mein Zustand stark, was mich allerdings nicht davon abhielt, in jeder möglichen Minute weiter zu recherchieren. Und dann, ganz plötzlich stieß ich auf Quellen, die von Heilung berichteten, davon erzählten, dass statistisch gesehen ein verschwindend kleiner Prozentsatz der Betroffenen eine Wunderheilung erfährt. Meine Schlagwörter der Recherchen änderten sich und auf einmal tat sich da eine Welt auf, von der ich wenige Tage vorher nicht mal zu träumen wagte.
Ich stieß auf einen Facebookpost einer Frau, die ihre Geschichte als CFS-Erkrankte erzählte, eine Geschichte, die damit endete, dass sie heute gesund ist und Betroffene dabei unterstützt, das auch zu schaffen. Schon kurz darauf muss meine Mail bei dieser Frau im Posteingang eingetroffen sein und wenige Wochen später saß ich bei ihr am Esstisch und erfuhr von all dem Wissen, dessen Anwendung mich zu Gesundheit führte. Heute, bald sechs Jahre später schreibe ich diese Zeilen in voller Dankbarkeit und mit dem Wunsch, ganz vielen Betroffenen ebenfalls die Begleitung Ihres Heilungsweg sein zu können.